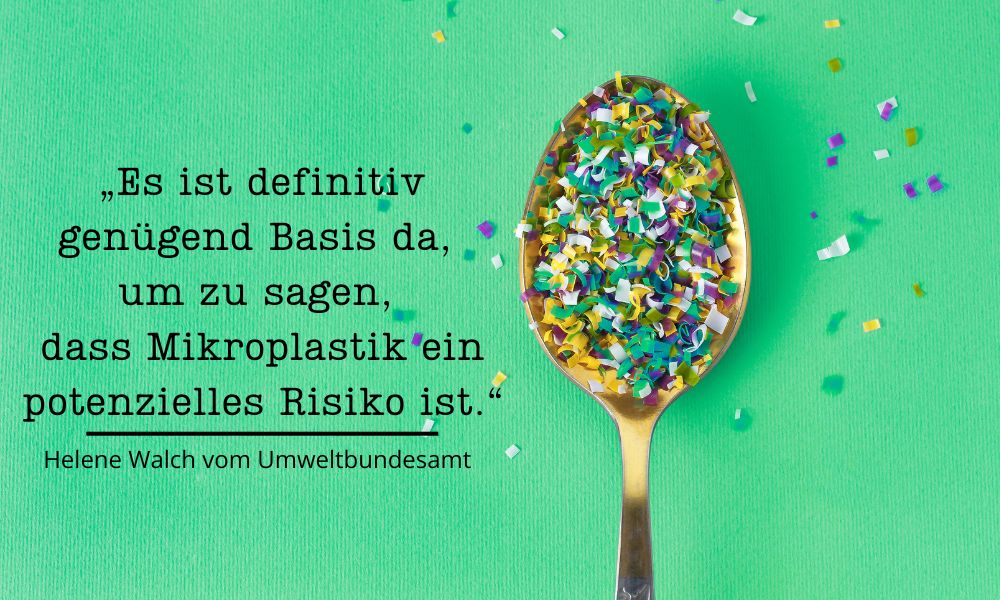Kunststoff hat unsere Welt in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend und auf vielfältige Weise geprägt. Der vielseitige Werkstoff bringt viele Vorteile mit sich, birgt jedoch in seiner kleinsten Form erhebliche Risiken – für Umwelt und Gesundheit.
Im Vorfeld der UNO-Verhandlungsrunde zur Eindämmung von Kunststoffverschmutzung, die vom 5. bis 14. August in Genf stattfindet, hat APA-Science Redaktion recherchiert, welche aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse es zu Mikroplastik gibt – und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden sollten.
Mikroplastik ist ein wachsendes globales Umwelt- und Gesundheitsproblem. Obwohl der Begriff erst 2004 geprägt wurde, zeigen aktuelle Studien, dass Mikro- und Nanoplastik heute fast überall nachweisbar sind – von Meeresgrund über Berggipfel bis ins menschliche Gewebe. Die Partikel entstehen u. a. durch Abrieb, Alterung von Kunststoffen und synthetische Textilien und gelangen über Luft, Nahrung oder Wasser in Mensch und Tier.
Gesundheitliche Risiken sind noch nicht eindeutig belegt, doch Hinweise auf mögliche Schäden an Organen, Zellen und dem Immunsystem verdichten sich. Mikroplastik kann sich mit Schadstoffen verbinden, Entzündungen fördern und möglicherweise sogar Krebs begünstigen. Die Forschung steckt jedoch noch in den Anfängen – auch wegen technischer Herausforderungen bei der Analyse.
Politisch wird ein globales Kunststoffabkommen verhandelt. Bisher scheitert es an unterschiedlichen Interessen (z. B. Produktionsbegrenzung vs. Abfallwirtschaft). Initiativen wie der österreichische „Aktionsplan Mikroplastik 2022–2025“ versuchen, auf nationaler Ebene gegenzusteuern. Prognosen gehen davon aus, dass sich die Kunststoffproduktion in den nächsten Jahrzehnten noch drastisch steigern wird – mit langfristig unklaren Folgen für Mensch, Tier und Umwelt.
Auch das bündnis mikroplastikfrei hat mit Beiträgen und Statements beim Entstehen des Beitrags mitgewirkt.
Den gesamten Artikel der APA Science Redaktion finden Sie hier: Mikroplastik – Vom Wunderwuzzi zum Problemfall